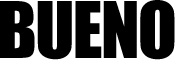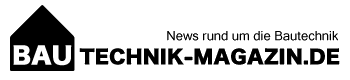Ökonomische Impulse für die Wohnungswirtschaft – Teil 4: Belegungsrechte
17 Mai
Im Februar-Newsletter erörterte unser Berater Thomas Lehmann den sozialen Wohnungsbau als eine Möglichkeit, um das Zugangsproblem zu Wohnungen zu lösen. Heute stellt er als Alternativinstrument den „Ankauf von Belegungsrechten“ vor.
Zugangsbarrieren beseitigen – eine politische Aufgabe
Die Beseitigung von Zugangsbarrieren für sozial schwächere Haushalte ist insbesondere in angespannten Marktphasen eine zentrale Aufgabe der Politik. Barriere bedeutet dabei, dass der nachfragende Haushalt grundsätzlich alle Zugangsvoraussetzungen erfüllt, ihm der Zugang aufgrund anderer sozialer Faktoren trotzdem verwehrt bleibt. In solchen Fällen reichen monetäre Instrumente wie das Wohngeld nicht mehr aus. Mit dem Ankauf von Belegungsrechten steht neben dem sozialen Wohnungsbau ein zusätzliches politisches Instrument zur Verfügung.
Wirkungsmechanismen von Belegungsrechten
Die Abbildung 1 gilt für einen Wohnungsmarkt ohne Zugangsprobleme. Angebot und Nachfrage treffen sich zu einem Marktpreis m1 mit der Wohnungsmenge wGes1. 1
Dieser Gleichgewichtspreis ist gerade in Phasen des Mietanstieges für einige Haushalte nicht mehr erschwinglich. Ihre eigentliche Zahlungsfähigkeit liegt unterhalb der Nachfragefunktion ohne Zugangsbarrieren (NachfrageI+IIa).
Diese reduzierte Zahlungskraft trifft für gewöhnlich auf ein geringeres Wohnungsangebot, denn weniger Vermieter sind bereit, ihre Wohnung zu diesem Preis zu vermieten (wGes1 zu wGes0). In dieser Situation kann die Kommune mit den Vermietern eine Prämie aushandeln, um das Zugangsproblem zu lösen: Durch die Prämie wird die geringere Zahlungsfähigkeit des bedürftigen Haushaltes (NachfrageI+IIa) auf die Ursprungsnachfragefunktion (NachfrageI+II) zurückgehebelt. Daraus resultiert der Mietpreis m+r im Gleichgewicht C. Die Prämie r ist dabei abhängig von der Dynamik des Wohnungsmarktes, der Elastizität des Angebotes und dem jeweiligen Mieter.2
Würden Belegungsrechte genau im Umfang des Bedarfs angekauft werden, würde sich das Gleichgewicht zurück zum Punkt G verlagern (Abbildung 1). Das Zugangsproblem wäre über den Umweg von Belegungsrechten beseitigt.3
Vor- und Nachteile gegenüber anderen Instrumenten
Das Instrument hat im Vergleich zu anderen klare Vor- aber auch Nachteile. Zu den Vorteilen gehört dabei, dass der sozialen Segregation entgegengewirkt wird und die soziale Durchmischung erhalten bleibt. Darüber hinaus ist die Treffsicherheit, wirklich bedürftige Haushalte zu berücksichtigen, vergleichsweise hoch. In Phasen der Marktentspannung könnten die Belegungsrechte wieder zurückgegeben oder nicht verlängert werden. Der Ankauf in Engpassphasen ist demgegenüber schwieriger und mit größeren Kosten verbunden.4
Ein Nachteil ist, dass der bloße Ankauf von Rechten keine Angebotsausweitung bedeutet. Auch Mitnahmeeffekte seitens der Vermieter, die Interessenten eine Wohnung auch ohne oder für eine geringere Prämie überlassen hätten, sollten nicht unterschätzt werden5. Dies erschwert es Kommunen, eine gerechte Prämie auszuhandeln.
Belegungsrechte als zukunftsträchtigste Lösung?
Allgemein punktet die Systematik damit, dass die eigentlich bedürftigen Haushalte erreicht werden, ohne dabei Missverhältnisse in der Stadtstruktur zu erzeugen. Zum Scheitern verurteilt ist das Modell dagegen, wenn die Kommune versucht, ihre Kosten und Pflichten durch Prämienzahlungen auf private Vermieter abzuwälzen.6
Im Ergebnis sind Belegungsrechte als leistungsfähig einzustufen. Folglich könnte ihr Erwerb „eine wichtige, wenn nicht die wichtigste Aufgabe in der künftigen Wohnungspolitik [sein]“.7
Im kommenden Newsletter folgt eine Zusammenfassung der in den vier Serienteilen vorgestellten Instrumente zur Sicherung bezahlbaren Wohnraums auch für sozial schlechter gestellte Mieter.
1 Der Gedankengang hinter der geknickten Nachfragefunktion des Gesamtwohnungsmarktes wurde in der vorherigen Ausgabe (Februar 2016) erläutert.
2 Vgl. Leonhardt, K., Wohnungspolitik in der Sozialen Marktwirtschaft, 1996, S. 165.; Vgl. Nolte, R. und Voß, O., Nachfrage- und Angebotswirkungen des Wohngeldes, 1997, S. 75 – 77.
3 Vgl. Vgl. Nolte, R. und Voß, O., Nachfrage- und Angebotswirkungen des Wohngeldes, 1997, S. 75 – 77.
4 Vgl. Voigtländer, M., Optionen für den bezahlbaren Wohnraum, IW policy paper 14/2015, S. 13. ; Vgl. Nolte, R. und Voß, O., Nachfrage- und Angebotswirkungen des Wohngeldes, 1997, S. 160f.
5 Vgl. Hubert, F. und Tomann, H., Der Erwerb von Belegungsrechten im Wohnungsbestand, 1991, S. 140f.
6 Vgl. Eekhoff, J., Wohnungspolitik, 2002, S. 188.
7 Ebenda, S. 189
Firmenkontakt und Herausgeber der Meldung:
BBT GmbH
Bernburger Straße 30/31
10963 Berlin
Telefon: +49 (30) 26006-0
Telefax: +49 (30) 26006-200
http://www.avestrategy.com/...
Dateianlagen: